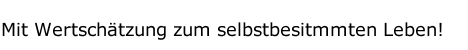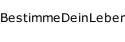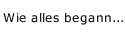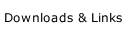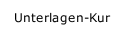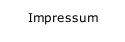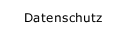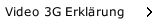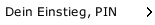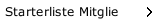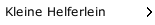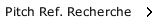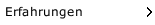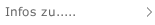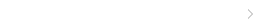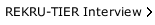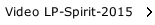Heftigste Schmerzen im Grundgelenk der großen Zehe sind oft das erste Symptom einer Gichterkrankung
nach obenÜberblick: Was ist Gicht?
Gicht ist eine Stoffwechselstörung, bei der sich die Harnsäurekonzentration im Blut erhöht. So bilden sich Harnsäurekristalle (Urat-Kristalle), die sich in Gelenken, Schleimbeuteln, Sehnen, in der Haut und im Ohrknorpel ablagern. Heftige Gelenkentzündungen und Gelenkschäden können entstehen. Auch in der Niere setzen sich die Kristalle ab. Bleibt die Gicht unbehandelt, kommt es leicht zu Nierensteinen und Nierenschäden.
Extrem heftige Schmerz-Attacken prägen den Beginn der Erkrankung und – ohne geeignete Therapie – auch den weiteren Verlauf. Oft ist beim akuten Gichtanfall als erstes die große Zehe, genauer das Großzehen-Grundgelenk, betroffen. Direkter Auslöser der Schmerzattacke ist nicht selten ein üppiges Mahl oder reichlicher Alkoholgenuss.
In Blutuntersuchungen lassen sich erhöhte Harnsäurespiegel aufdecken. Die richtige Ernährung, eine gesunde Lebensweise und Medikamente helfen, die Harnsäurewerte zu senken, Gichtattacken vorzubeugen und Komplikationen zu vermeiden, die bei chronischer Gicht drohen.
Etwa 80 Prozent der Gichtpatienten sind Männer. Die Krankheit trifft sie meist zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr, selten in jüngeren Jahren. Frauen bekommen eine Gicht üblicherweise nicht vor Einsetzen der Wechseljahre. Offenbar bieten die weiblichen Geschlechtshormone bis zu diesem Zeitpunkt einen gewissen Schutz.
Bei den meisten Gichtkranken besteht eine angeborene Neigung zu einem erhöhten Harnsäurespiegel. Verschiedene Auslöser begünstigen jedoch den Ausbruch der Gicht, darunter Krankheiten, Medikamente, aber auch eine ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht. Die Störung wird daher oft als "Wohlstandskrankheit" bezeichnet.
nach obenGicht: Ursachen
Die Voraussetzung dafür, dass sich überhaupt eine Gicht entwickeln kann, ist ein Zuviel an Harnsäure im Blut – medizinisch heißt das Hyperurikämie. Eine Hyperurikämie stellt sich immer dann ein, wenn das Gleichgewicht zwischen Bildung und Ausscheidung der Harnsäure im Körper gestört wird. Harnsäure wird vor allem über die Nieren, und nur zu einem kleinen Teil über den Darm ausgeschieden. Bei etwa fünf Prozent der erwachsenen Männer lassen sich erhöhte Konzentrationen an Harnsäure im Blut nachweisen, die aber anfangs keine Beschwerden verursachen. Ob eine Gicht auftritt, hängt von der Dauer und vom Grad der Hyperurikämie ab.
Warum ist der Harnsäurespiegel erhöht?
Harnsäure entsteht im Körper aus dem Abbau von Purinen. Diese wiederum stammen aus zwei Quellen:
- Zu einem stecken Purine in der Nahrung. Besonders purinreich sind beispielsweise Innereien, Fleisch und Wurst.
- Zum anderen sind Purine ein normaler Baustein von Körperzellen. Purine werden daher im Organismus auch stets beim Abbau oder beim Zerfall von Zellen frei.
Für einen Harnsäureüberschuss im Blut gibt es im Wesentlichen drei mögliche Ursachen:
1. Im täglichen Essen stecken zu viele Purine. Sie werden zu Harnsäure abgebaut.
2. Im Körper entsteht verstärkt Harnsäure, zum Beispiel weil viele Zellen zerfallen.
3. Die Nieren scheiden zu wenig Harnsäure aus.
Häufig finden sich Kombinationen der genannten Fehlsteuerungen. Genetische Veränderungen spielen bei der Entstehung der Gicht eine wichtige Rolle. So finden sich bei Verwandten von Gichtkranken oft ebenfalls erhöhte Harnsäurespiegel. Ärzte unterscheiden verschiedene Formen der Gicht:
Primäre Form: Ursache der Hyperurikämie ist ein angeborener Stoffwechseldefekt. Fast immer scheidet die Niere weniger Harnsäure aus als nötig wäre. Nur in sehr seltenen Fällen ist ein Enzymdefekt schuld daran, dass der Körper zu viel Harnsäure herstellt.
Sekundäre Form: Die Hyperurikämie wird durch andere Krankheiten oder Störungen hervorgerufen. Eine sekundäre Gicht entsteht beispielsweise als Folge von Leukämie oder anderen Blutkrankheiten, bei denen viele Zellen abgebaut werden, bei Nierenerkrankungen, oder manchmal bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten.
Was kann Gichtanfälle auslösen?
Besteht bereits eine versteckte Neigung zu Gicht, wirken äußere Faktoren krankheitsfördernd oder anfallauslösend. Zu diesen Faktoren gehören vor allem purinreiche Lebensmittel und alkoholische Getränke, aber auch Stoffwechselschwankungen, wie sie bei strengen Diäten oder manchmal bei Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) vorkommen. Auch körperlicher Stress – zum Beispiel durch Verletzungen, ungewöhnliche Anstrengungen oder Infektionen – kann eine akute Gichtattacke provozieren.
nach obenGicht: Symptome
Der erste Gichtanfall zeigt sich meistens an einem einzigen Gelenk (akute Gichtarthritis). Sehr häufig handelt es sich dabei um das Grundgelenk der großen Zehe. Diese Form der Gicht wird auch Podagra genannt. Andere Gelenke, die ebenfalls oft befallen werden, sind Mittelfußgelenke, Sprung- und Kniegelenke, sowie Daumengrundgelenke.
Wie macht sich ein Gichtanfall bemerkbar?
Tückischerweise tritt ein akuter Gichtanfall fast immer ohne Vorwarnung bei scheinbar völlig gesunden Menschen auf. Die Betroffenen werden meist nachts oder in den frühen Morgenstunden ganz plötzlich von einer sehr schweren Schmerzattacke überfallen. Typischerweise ist das kranke Gelenk extrem berührungsempfindlich und bewegungsschmerzhaft, es ist außerdem teigig geschwollen, gerötet oder bläulich verfärbt und heiß. Der Anfall wird vielfach auch von Fieber begleitet.
Der akute Zustand kann mehrere Stunden und sogar Tage lang andauern, wenn keine geeignete Therapie erfolgt. Ohne weitere ärztliche Behandlung werden sich die akuten Attacken wiederholen, können dann in immer kürzeren Abständen auftreten und jeweils länger anhalten sowie auf andere Gelenke übergreifen.
Was sind Gicht-Tophi?
Harnsäurekristalle lagern sich in Gelenken, Schleimbeuteln, Sehnen, Haut, Ohrknorpel und Nieren ab. Es können sich – vor allem an der Ohrmuschel, im Gelenk oder seiner Umgebung – sichtbare Knötchen bilden, sogenannte Gicht-Tophi. Das sind größere Verklumpungen von Harnsäurekristallen. Dank moderner Therapiemethoden kommen Tophi heutzutage aber nur noch selten vor.
Wird die Krankheit nicht ausreichend behandelt, führt sie zu ernsten Komplikationen: dazu gehören chronische Gelenkentzündungen und –deformierungen mit Knochenschäden, Schleimbeutelentzündungen, Nierensteine und eine Nierenschwäche bis hin zum Nierenversagen(Gichtniere). Bei dieser chronischen Gicht leiden Betroffene oft unter anhaltenden Gelenkschmerzen oder Gelenkschwellungen.
Die frühzeitige Therapie hilft, solche schweren Folgen zu vermeiden.
Beim akuten Gichtanfall ist der Harnsäure-Wert im Blut nicht immer erhöht
nach obenGicht: Diagnose
Die Beschwerden und Zeichen des akuten Gichtanfalls sind oft sehr charakteristisch, so dass der Arzt in der Regel die richtige Verdachtsdiagnose stellen kann.
Der typische "Lehrbuchfall", der mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen akuten Gichtanfall spricht, sieht folgendermaßen aus: Eine plötzliche extrem schmerzhafte Entzündung am Zehengrundgelenk bei einem über 40-jährigen Mann, der am Abend zuvor mit reichlichem Essen und Alkoholgenuss ordentlich gefeiert hat.
Der individuelle Fall kann natürlich von diesem Muster abweichen. So können beispielsweise auch Infekte oder eine starke Anstrengung einen Anfall provozieren. Fieber, Kopfschmerzen und Unwohlsein können einem Gichtanfall auch vorausgehen. Wenn die Symptome nicht eindeutig sind, wird der Arzt weitere Untersuchungen veranlassen.
Mit einer Blutuntersuchung lässt sich der aktuelle Harnsäurewert feststellen. Er ist bei einem akuten Anfall jedoch nicht immer auffällig, sondern kann bereits wieder im Normalbereich liegen. Aussagekräftiger sind wiederholte Harnsäure-Untersuchungen. Oft finden sich beim Gichtanfall aber deutliche Entzündungszeichen im Blut.
In unklaren Fällen hilft eine Gelenkpunktion mit Untersuchung der Gelenkflüssigkeit, die Diagnose zu sichern. Unter dem Mikroskop sind darin Harnsäurekristalle zu sehen.
Bei fortgeschrittener Gicht zeigt das Röntgenbild eventuell typische Gelenkveränderungen.
Patienten, die an Gicht leiden, haben überdurchschnittlich häufig auch Übergewicht, Bluthochdruck, ungünstige Blutfettwerte und Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) vier wichtige Risikofaktoren für Herz- und Kreislaufkrankheiten, die unter dem Begriff metabolisches Syndromzusammengefasst werden. Der Arzt wird in der Regel auch untersuchen, ob die genannten Risiken vorliegen und eventuell behandelt werden müssen.
nach obenGicht: Therapie
Gegen den akuten Gichtanfall verschreibt der Arzt Medikamente. Infrage kommen:
- bestimmte entzündungshemmende kortisonfreie Antirheumatika
- Colchicin
- Kortisonpräparate als Tabletten oder als Spritze ins Gelenk.
Außerdem wird er einige Allgemeinmaßnahmen empfehlen:
- das betroffene Gelenk hoch lagern
- gegebenenfalls Bettruhe
- die Bettdecke vom empfindlichen Gelenk fernhalten
- kühlende Umschläge
- leichte, purinarme Kost
- ausreichend trinken.
Nach der Akutphase zielt die Dauerbehandlung der Gicht darauf ab, den Harnsäurespiegel zu normalisieren und stabil zu halten sowie zu verhindern, dass wiederholt Gichtanfälle auftreten und die Krankheit weiter fortschreitet.
Folgende Medikamente kommen dabei zum Einsatz:
- Colchicin, für einige Monate begleitend zur übrigen Medikation zur Vorbeugung von Gichtanfällen
- Allopurinol, ein Medikament, das die Bildung der Harnsäure unterdrückt (ein sogenanntes Urikostatikum)
- Febuxostat, ein neu entwickelter Wirkstoff. Er kann alternativ zu Allopurinol eingesetzt werden, um erhöhte Harnsäurespiegel zu senken, die bereits zu Ablagerungen geführt haben
- Medikamente, die die Ausscheidung von Harnsäure fördern (Urikosurika), zum Beispiel Benzbromaron
- gegebenenfalls Medikamente gegen Schmerzen und Entzündung.
Wichtig: Lebens- und Essgewohnheiten ändern
- umstellen auf eine purinarme Kost
- sehr üppige Mahlzeiten, Fasten und Durstphasen vermeiden
- mindestens zwei Liter Flüssigkeit am Tag trinken, sofern aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht
- Alkoholgenuss stoppen
- Übergewicht langsam reduzieren – durch gesunde Ernährung und viel Bewegung. Auf "Radikaldiäten" verzichten
- Körperliche Aktivität. Sie hilft, den Harnsäurespiegel zu senken
Der Arzt wird außerdem die Harnsäurewerte im Blut regelmäßig überprüfen. Bei chronischer Gicht mit Gelenkschmerzen können eventuell physikalische Therapien lindernd wirken.
nach obenErnährung bei Gicht
Die allgemeinen Grundsätze für eine ausgewogene und gesunde Ernährung gelten auch für Patienten mit Gicht. Sie müssen allerdings zusätzlich darauf achten, purinreiche Lebensmittel zu meiden. Denn aus Purinen in der Nahrung bildet der Körper Harnsäure. Ziel ist es, den Harnsäurewert im Blut möglichst unter sechs Milligramm pro Deziliter zu halten.
Die richtige Ernährung ist eine wichtige Säule der Therapie und hilft im günstigen Fall, Medikamente einzusparen. Der Arzt wird die Blutwerte regelmäßig kontrollieren, um den Erfolg der Behandlung zu überprüfen.
Purinarm essen
Die Harnsäure stammt aus den Purinen in der Nahrung. In speziellen Nährstofftabellen ist der Harnsäuregehalt von Lebensmitteln angegeben. Diese Tabellen sind für Gichtpatienten sehr hilfreich und notwendig bei der täglichen Zusammenstellung des Speiseplans.
Gichtpatienten sollten nicht mehr als 500 mg (Milligramm) Harnsäure pro Tag zu sich nehmen und nicht mehr als 3000 mg pro Woche. Bei einem akuten Gichtanfall verordnet der Arzt oft sogar noch strengere Obergrenzen von maximal 300 mg Harnsäure pro Tag, oder 2000 mg pro Woche.
Betroffene Patienten lassen sich über die Einzelheiten am besten von Ernährungsberatern, auch im Rahmen von bestimmten Patientenschulungen, informieren. Dies kann der behandelnde Arzt vermitteln.
Die wichtigsten Regeln:
- Vorsicht bei Fleisch, bestimmten Fischsorten, Hülsenfrüchten (wie Erbsen, Linsen, weiße Bohnen) und Hefe. Sie sind sehr purinreich! Hier ist Zurückhaltung geboten. Auf die äußerst purinreichen Innereien am besten ganz verzichten.
- Auch eine hohe Fettzufuhr ist ungünstig. Lebensmittel möglichst fettarm zubereiten (dünsten, grillen).
- Als gute Quelle für Eiweiß kommen Milch- und Milchprodukte sowie Eier infrage.
- Günstige Lebensmittel sind – mit Ausnahmen – Obst, Gemüse, Salate, Kartoffeln. Eher purinreich und damit ungünstig sind zum Beispiel Spinat und Rosenkohl.
- Vitamin C hat einen milden harnsäuresenkenden Effekt.
Fleisch am besten kochen: Beim Kochen gelangen die Purine teilweise aus dem Fleisch in die Brühe. Sie kann dann zum Beispiel gesondert verwendet werden.
Was außerdem zu beachten ist
Gichtpatienten sollten auf eine ausreichende Trinkmenge von zwei bis drei Litern Flüssigkeit pro Tag achten, sofern aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht. Geeignete Getränke sind zum Beispiel Leitungs- und Mineralwasser, Tee und Kaffee. Von gesüßten Limonaden und Cola ist abzuraten.
Äußerste Zurückhaltung ist bei alkoholischen Getränken geboten! Alkohol beeinflusst den Stoffwechsel so, dass der Harnsäurespiegel im Blut ansteigt. Bier ist besonders schädlich für Gichtkranke, weil es obendrein auch noch purinreich ist.
Übergewicht ist ein bedeutender Risikofaktor für Hyperurikämie und Gicht. Deshalb sollte die Gewichtabnahme ein bewusstes Behandlungsziel sein. Doch Vorsicht: Strenges Fasten kann einen akuten Gichtanfall auslösen und ist deshalb tabu. Das ideale Gewicht sollte lieber allmählich durch viel Bewegung und eine gesunde, fettarme Küche erreicht werden.
Sehr üppige Mahlzeiten sind ebenso ungünstig wie Hungern oder längere Durstphasen. Wer an Gicht leidet, sollte versuchen, solche Extreme zu vermeiden.
nach obenBeratender Experte
Professor Dr. med. Bernhard Manger ist Facharzt für Innere Medizin mit den Teilgebieten Rheumatologie und Hämatologie. Seit 1988 arbeitet er als Oberarzt an der Medizinischen Klinik III mit Schwerpunkten Rheumatologie, Klinische Immunologie und Allergologie der Universität Erlangen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Entstehung, Diagnose und Therapie entzündlich-rheumatischer Erkrankungen.
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder –behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.